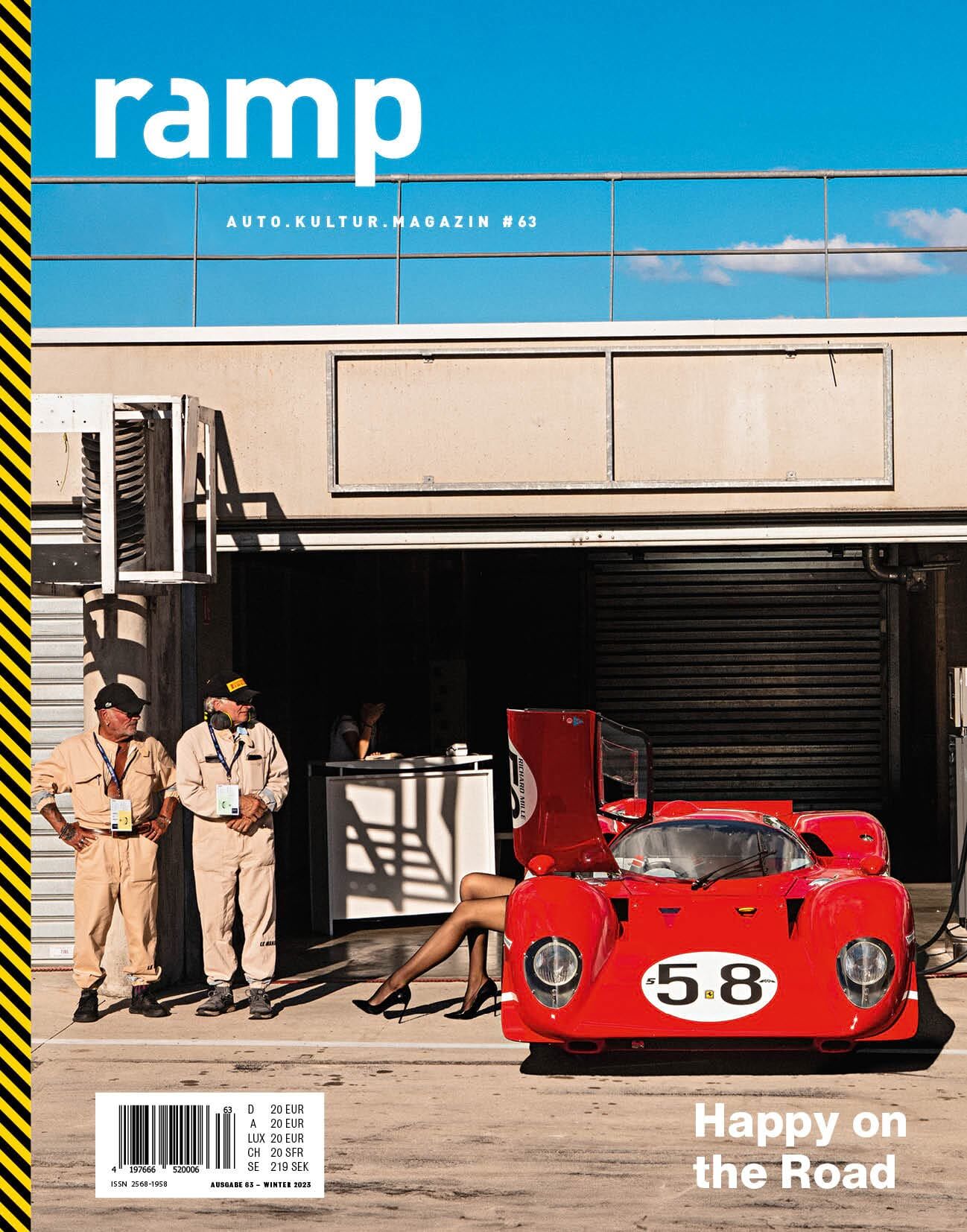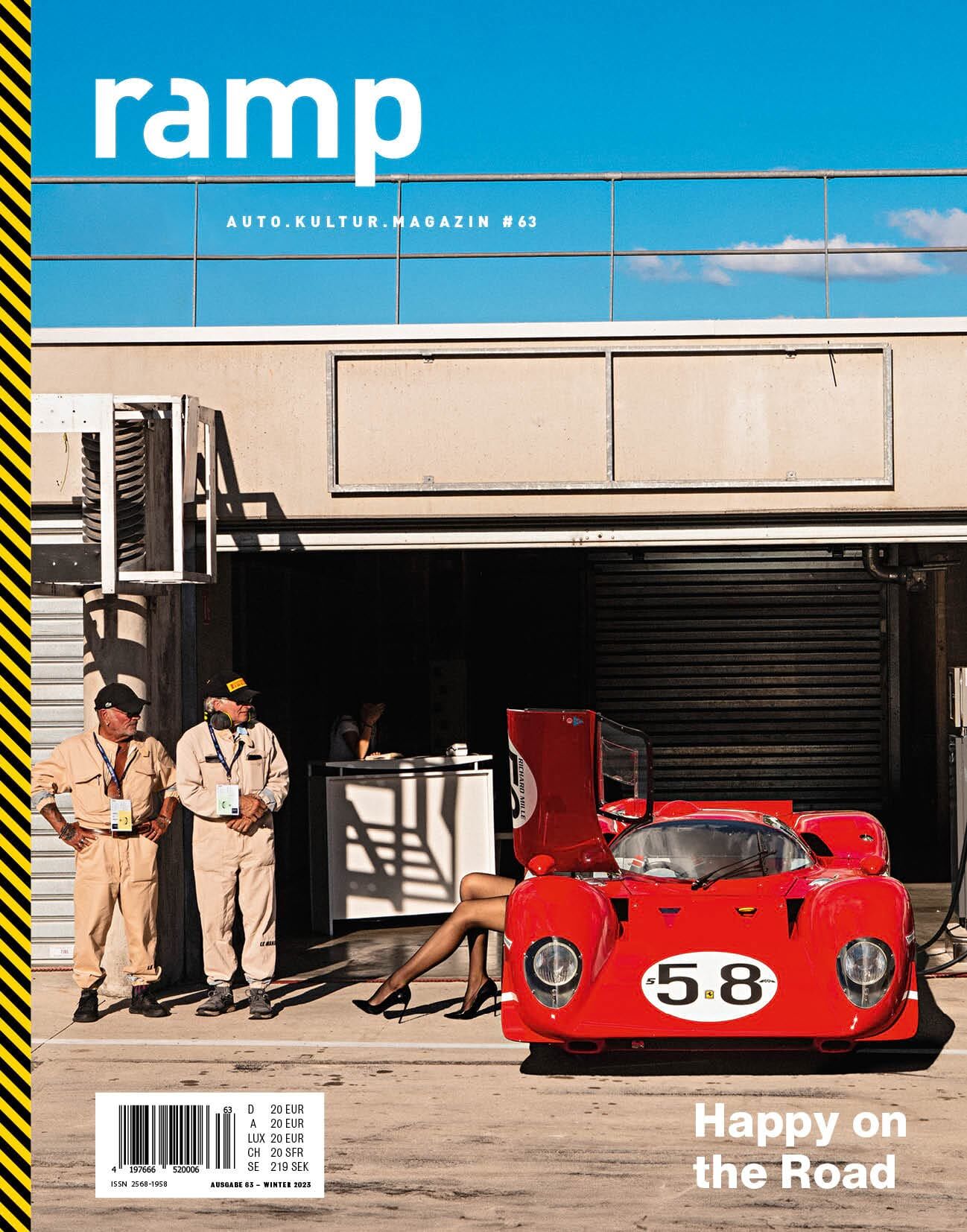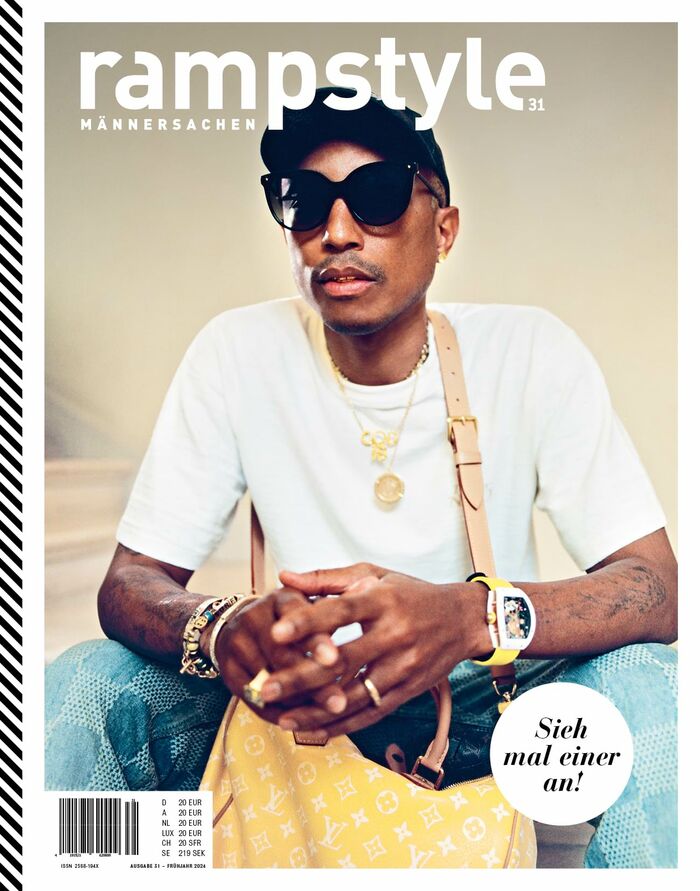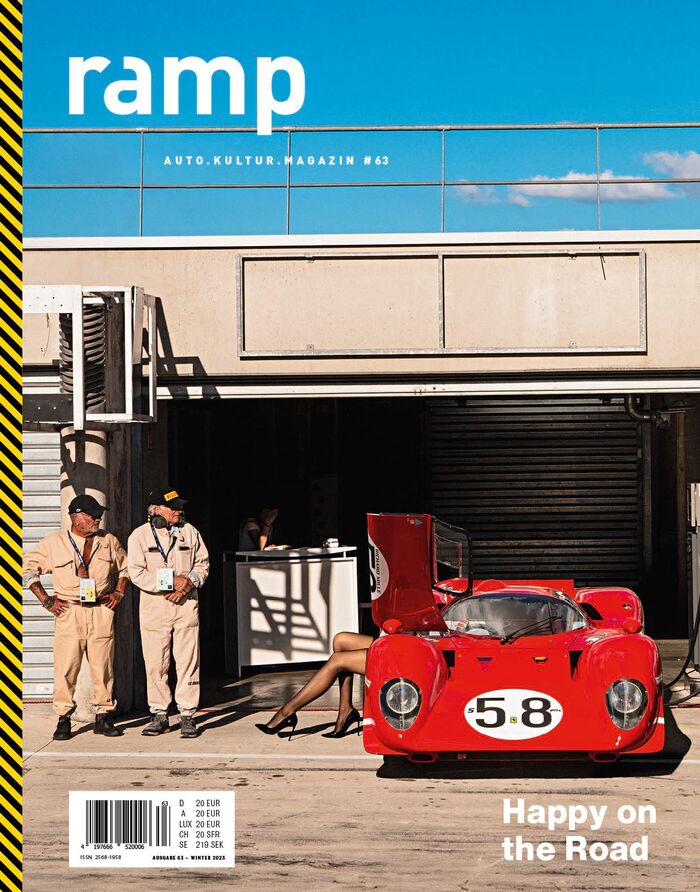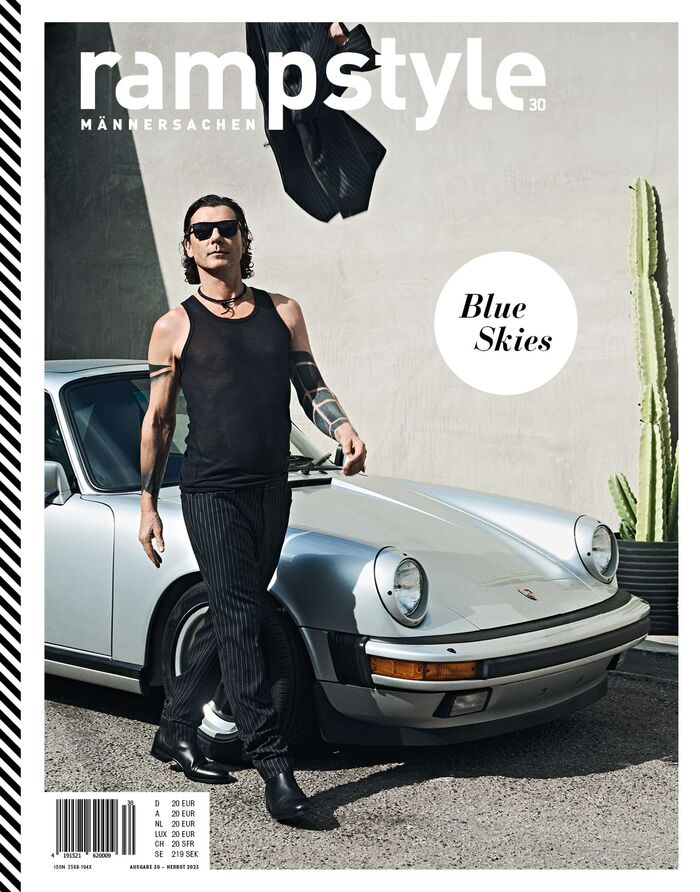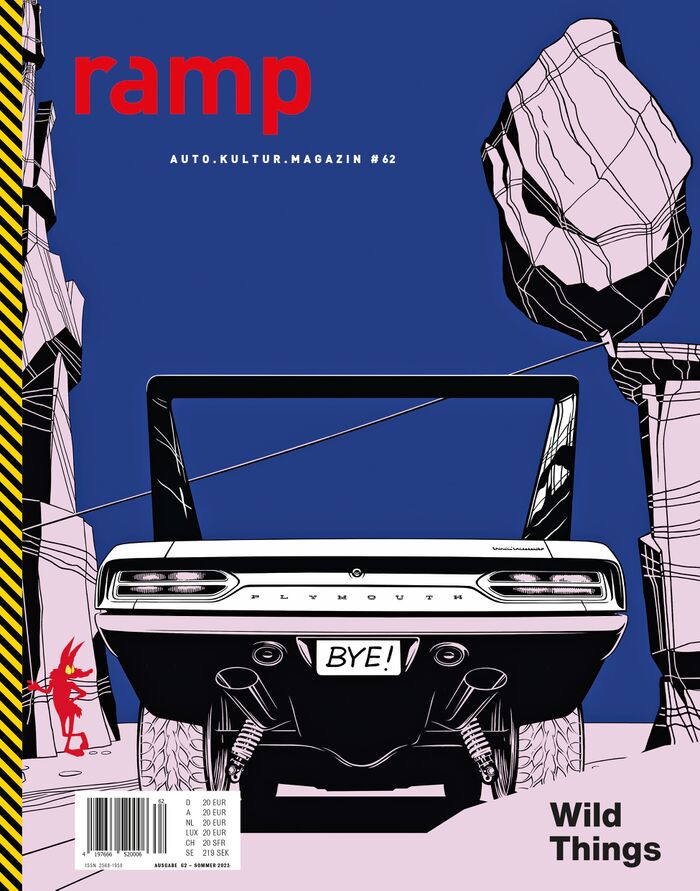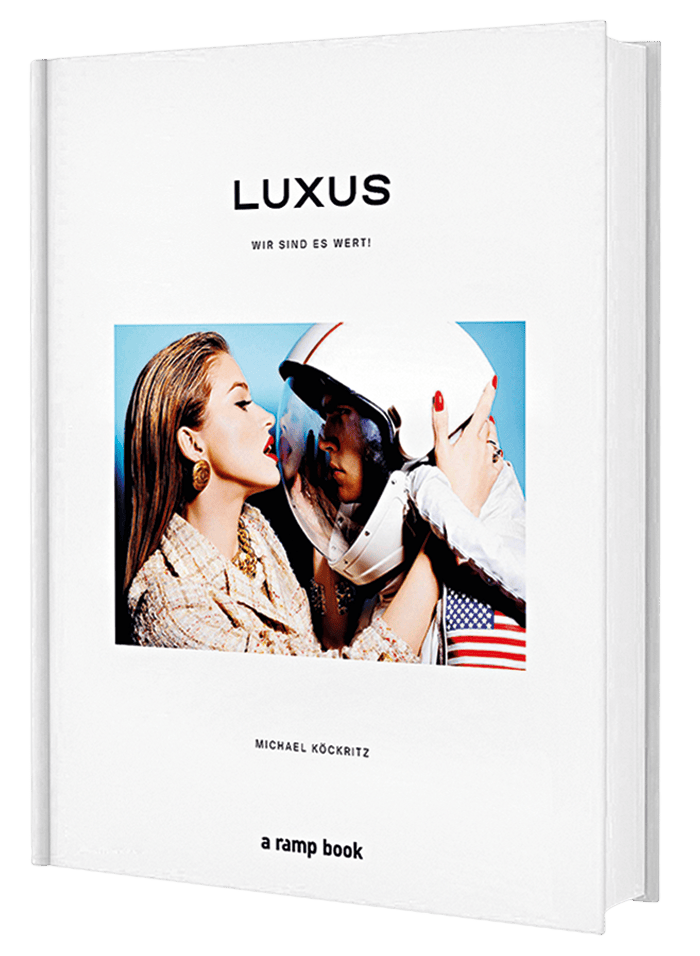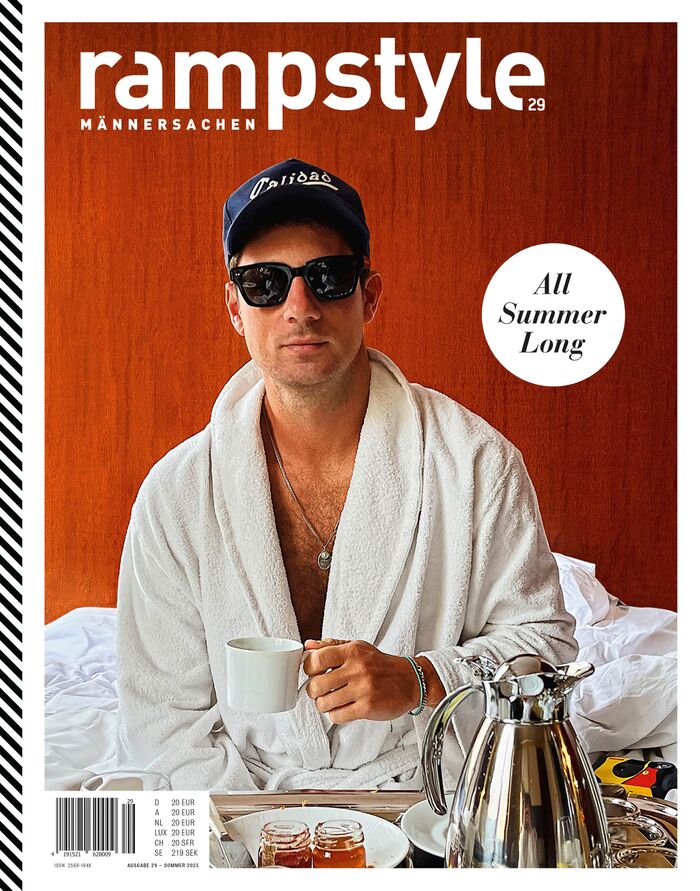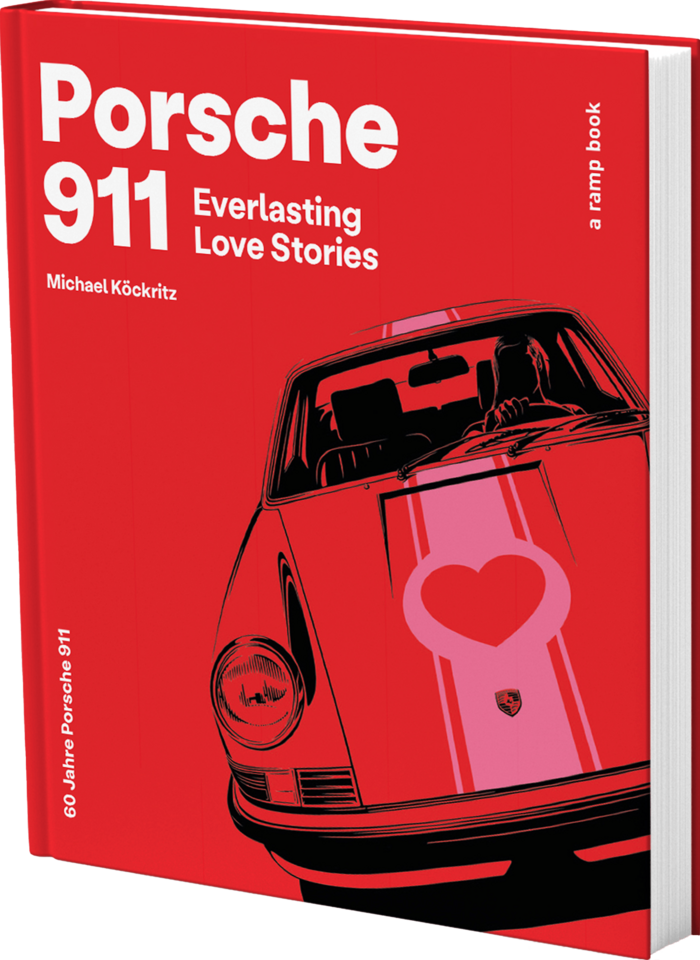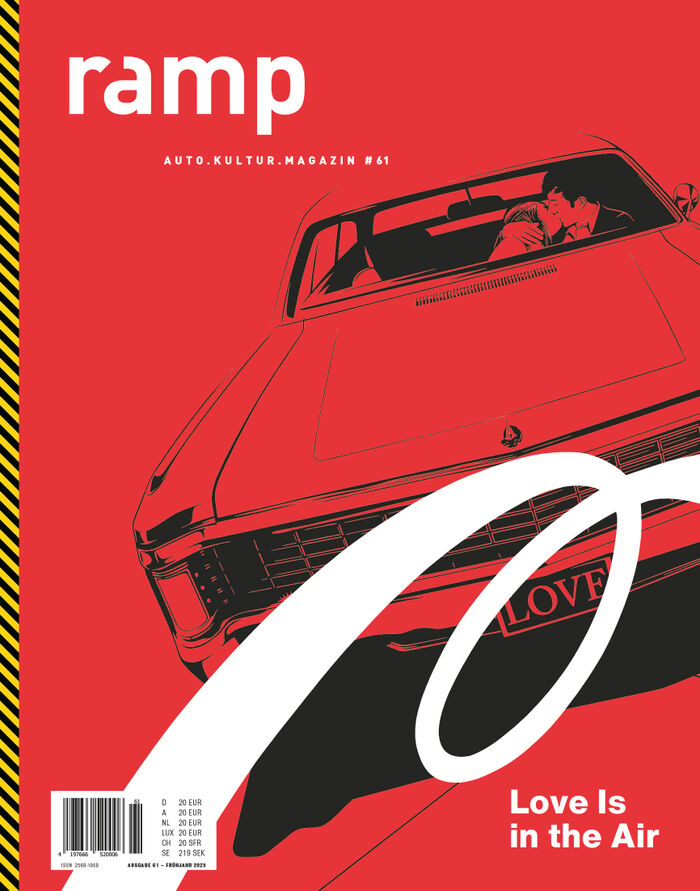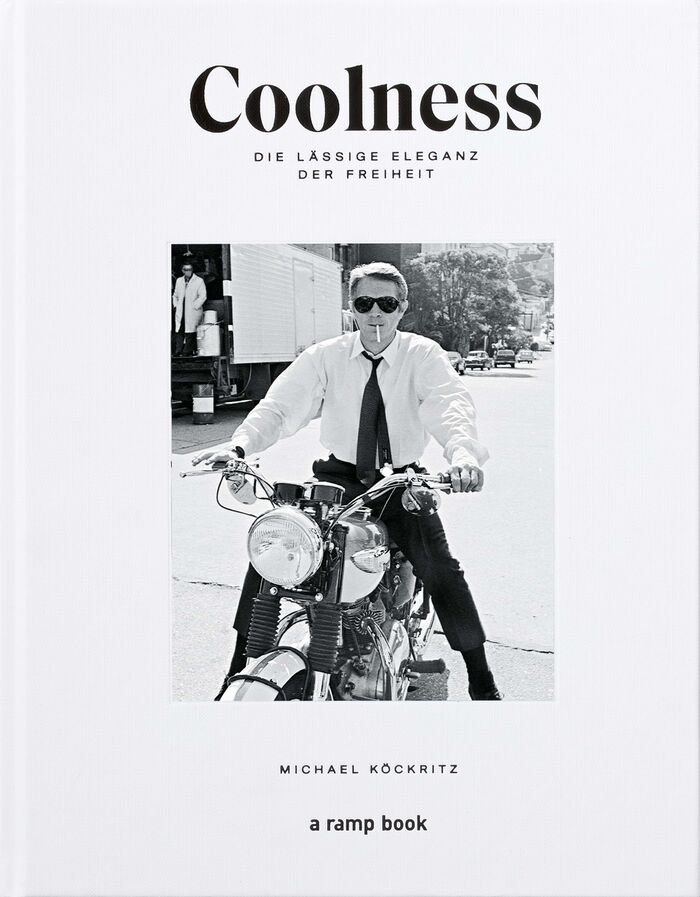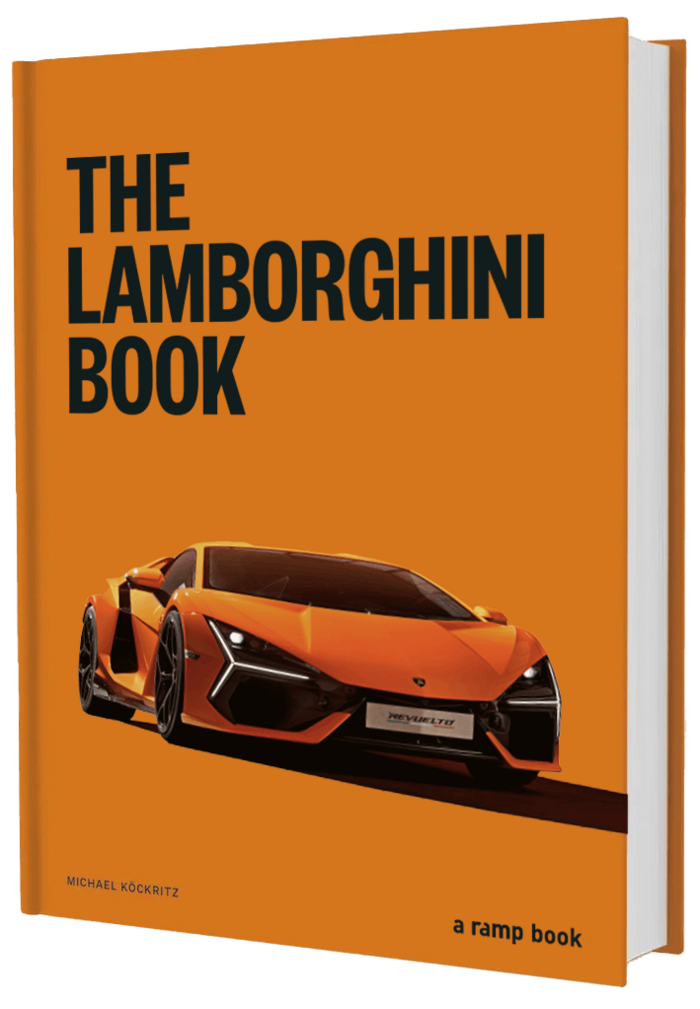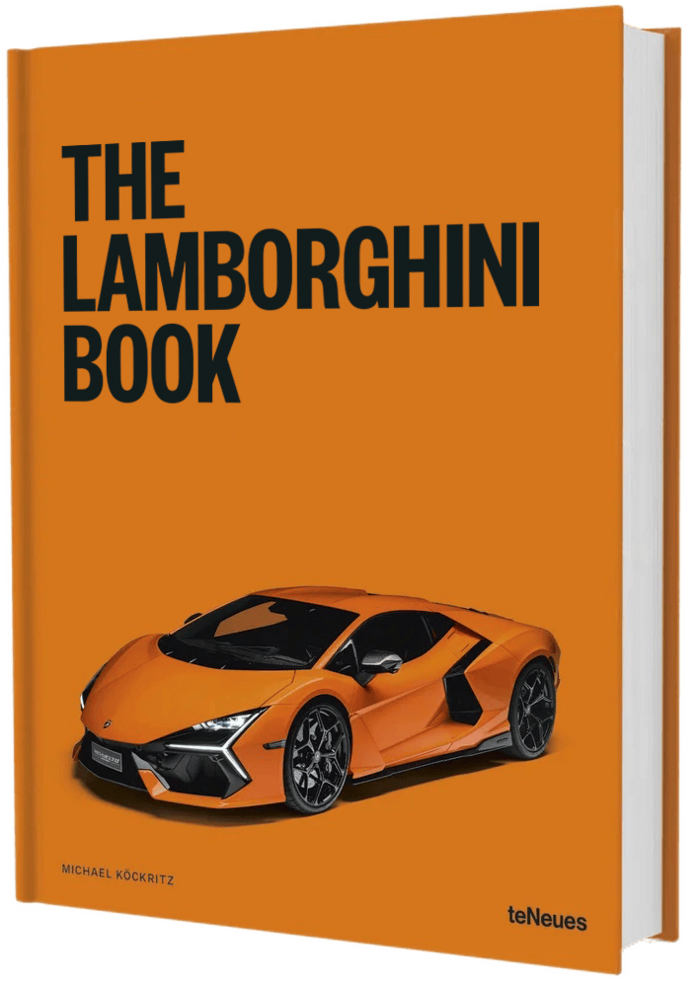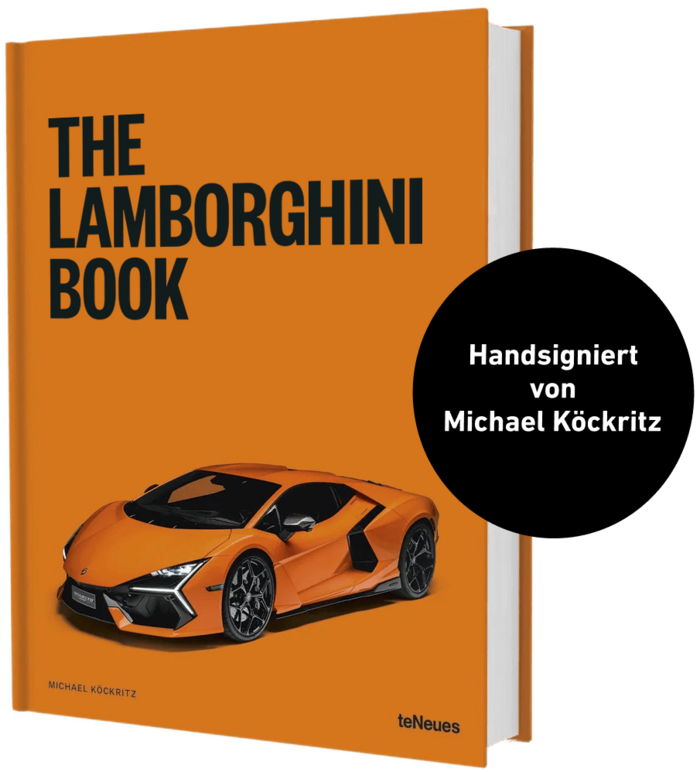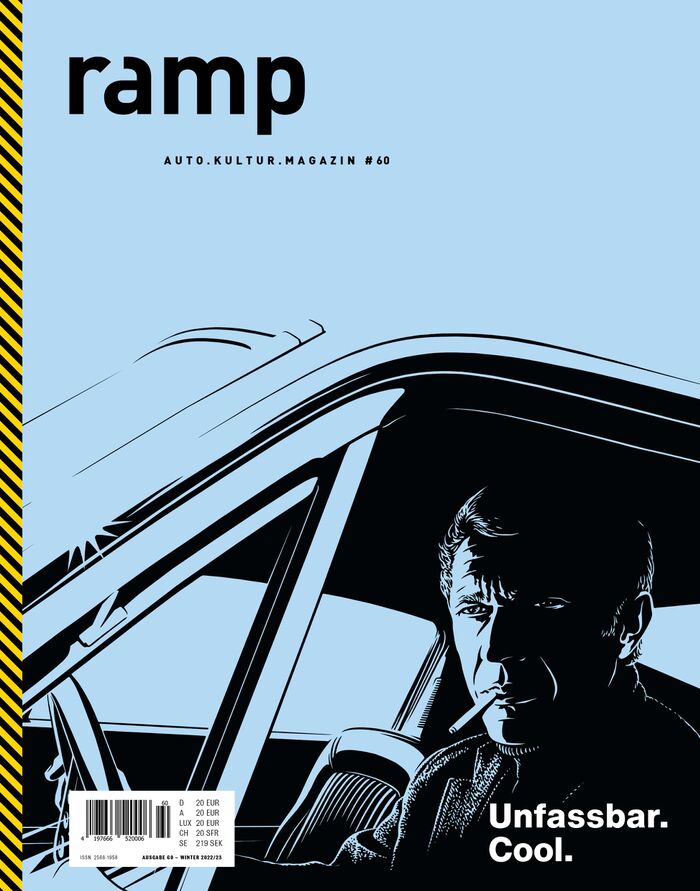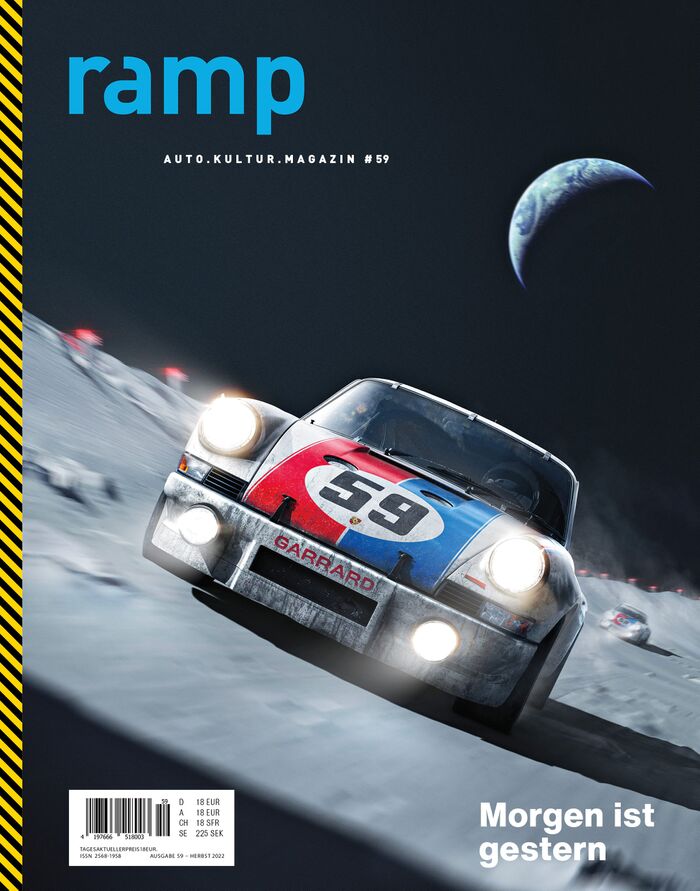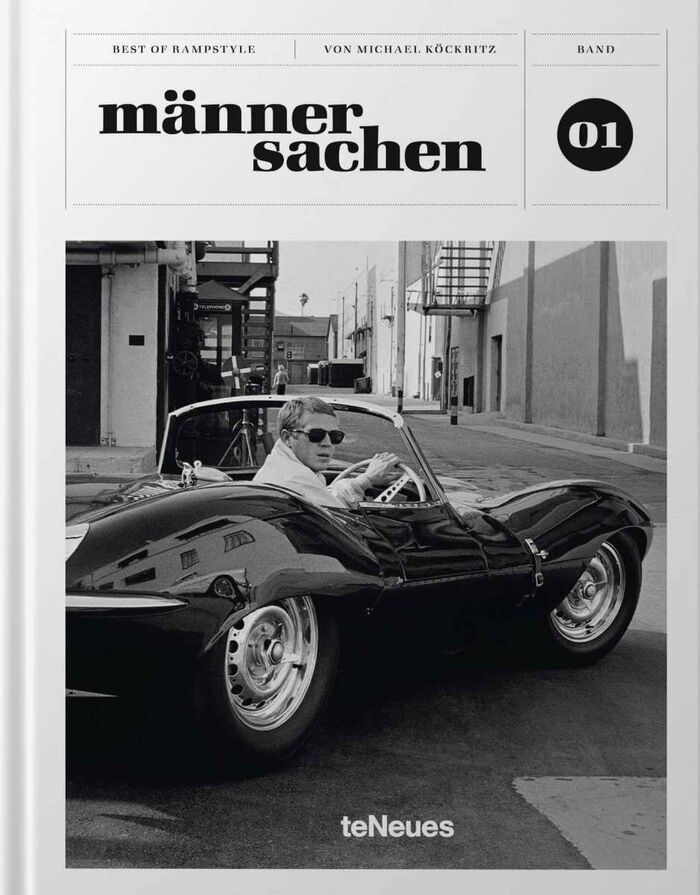Der Nimbus des Fahrens ist untrennbar mit dem Freiheitsversprechen verbunden, das die Steuerung eines Automobils verspricht. Doch aktuell ist diese Aura vor allem durch das Gespenst des autonomen Fahrens bedroht. Nun übernimmt ein ausgeklügelter Algorithmus die Steuerung des Fahrzeugs, der Insasse mutiert vom Herrscher über Schaltung, Getriebe, Motor und Räder zum Fahrgast. Aber lässt sich von jemandem, der gefahren wird, überhaupt sagen, dass er fährt? Der amerikanische Philosoph und bekennende Anhänger des Verbrennungsmotors Matthew B. Crawford, Autor einer voluminösen Philosophie des Fahrens, sieht in der Utopie des autonomen Automobils den entscheidenden Angriff auf alles, was die Lust am Fahren und das Wesen des Automobils ausmacht.
Wer auf Rädern fährt, ist nicht allein. Das Gefühl, einsam in seinem Auto eine Landschaft zu durchstreifen, trügt. Wenn auch nicht unmittelbar, ist die Gemeinschaft stets präsent: als Straße. Graues Band, weiße Streifen, grüner Rand. Viel zu selten wird bedacht, dass Straßen kein Gottesgeschenk, sondern Resultat menschlicher Aktivitäten sind, angelegt, um dem Fahren überhaupt eine Chance zu geben. Sieht man von geländegängigen Fahrzeugen ab, erforderte das mit Rädern ausgestattete Fuhrwerk von Anbeginn an das Anlegen von breiteren Wegen und Straßen, um ein halbwegs effizientes Vorankommen zu ermöglichen. Im Gegensatz zum Fußgänger oder zum Reiter, die sich durch unwegsames Gelände schlagen können, scheitert das konventionelle Fahrzeug am kleinsten Hindernis. Wer fahren will, benötigt nicht nur ein entsprechendes Vehikel mit einem geeigneten Antrieb. Wer fahren will, benötigt vor allem eine Fahrbahn, die den Rädern jenes leichte Rollen ermöglicht, das das Fahren zu einem Erlebnis werden lässt.